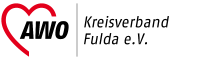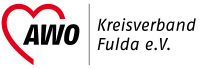„Ich habe ein halbes Jahr lang nur Deutsch gelernt“
Im Januar 2002 formulierte Collette Wanjugu Döppner ein ehrgeiziges Ziel: In nur einem halben Jahr wollte sie die deutsche Sprache so gut beherrschen, dass sie ein Masterstudium beginnen konnte. Das gelang ihr. Heute ist die gebürtige Kenianerin stellvertretende Vorsitzende des AWO-Kreisverbands Fulda und lehrt als Dozentin an der Hochschule Fulda. Im Interview berichtet sie über die Unterschiede zwischen ihrer Heimat und Deutschland und ihren Erfahrungen mit Rassismus.
Du bist stellvertretende Vorsitzende der AWO. Was motiviert dich zu diesem Ehrenamt?
Meine Motivation hat mit meinem Hintergrund zu tun. Ich komme ursprünglich aus Kenia, bin dort geboren und kam als Erwachsene nach Deutschland. In Kenia ist es so, dass durch die ökonomische Lage viele Menschen aufeinander angewiesen sind. Man nennt es eine Art Kollektivismus, dass die Leute unbedingt einander helfen müssen, um durchzukommen. So etwas wie den Kollektivismus in Kenia habe ich in Deutschland zunächst nicht wahrgenommen. Meine Schwiegermutter schlug mir dann vor, mich bei der AWO zu engagieren. Die Parallelen, das Helfen und Füreinandereinstehen waren da. Bei der AWO zu sein, gibt mir daher ein Stück Heimatgefühl. Es geht um ein Miteinander, gemeinsam Dinge zu tun, die anderen helfen. Daher kommt meine Motivation.
Welche Aufgaben übernimmst du als stellvertretende Vorsitzende?
Wir sprechen im Vorstand über die Projekte und die Finanzierung. Als Stellvertreterin arbeite ich eng mit unserem Geschäftsführer und Bernhard Lindner zusammen, um zu schauen, dass die AWO nach außen gut repräsentiert ist. Wenn es Veranstaltungen gibt, klären wir, wer vor Ort sein wird. Die Idee ist es, die AWO nicht nur von innen zu unterstützen, sondern auch nach außen zu vertreten. Von daher bin ich quasi wie ein Aushängeschild.
Seit wann bist du stellvertretende Vorsitzende?
Seit etwas mehr als sechs Jahren. Davor war ich Beisitzerin, und davor habe ich ehrenamtlich Kindern Nachhilfe in Englisch gegeben. So kam ich mit der AWO in Kontakt. Dann lernte ich andere Bereiche kennen, wurde als Beisitzerin vorgeschlagen. Und vier Jahre später wurde ich stellvertretende Vorsitzende.
Ist es dir schwergefallen, dich für den stellvertretenden Vorsitz und damit eine größere Verantwortung zu entscheiden?
Ja tatsächlich. Ich hatte anfangs großen Respekt vor dieser Verantwortung. Ich musste viel darüber wissen, wie die AWO funktioniert. Ich musste mich vor wichtigen Entscheidungen im Vorstand sehr gut darüber informieren, worum es ging. Ich hatte anfangs Zweifel, weil es viel Zeit kostet. Man muss viel lesen, über aktuelle Geschehnisse informiert sein. Ich war damals eine junge berufstätige Mutter mit zwei Kindern. Ich dachte, das wird sicher schwierig. Aber durch das Team und die gegenseitige Unterstützung ging das. Daher fiel es mir nicht schwer, in diese Aufgabe hineinzuwachsen.
Wieso Collette die AWO zunächst fremd war
Wie hast du deine Anfänge bei der AWO empfunden? Sicher war das erstmal etwas Neues und Anderes.
Tatsächlich fand ich die Umgebung sehr fremd. Ich war vorher noch nie in so einer Organisation. In Kenia war ich nie richtig an sowas interessiert. Es war daher sehr befremdlich, sehr neu. Ich brauchte eine Zeit lang, um mich daran zu gewöhnen. Aber das Team war sehr nett, freundlich, offen für Fragen. Wenn ich etwas nicht verstanden habe, waren sie immer da. Das schöne war, dass das Team sowohl aus Menschen bestand, die schon lange dabei waren als auch aus welchen, die wie ich neu dazukamen. Das war eine gute Mischung. Irgendwann fühlte ich mich nicht mehr komisch, wenn ich Fragen stellte.
Wem würdest du heute eine AWO-Mitgliedschaft empfehlen? Welche Menschen passen in die AWO?
Am meisten würde ich mich darüber freuen, wenn junge Leute beitreten. Denn diese Mischung zwischen älteren und jüngeren ist immer gut. Man kann voneinander lernen. AWO ist ja nicht nur das Altenheim, sondern auch die Jugendhilfe, die Schulbetreuung usw.
Wann bist du in die AWO eingetreten?
Kurz nachdem ich nach Deutschland kam, so gegen 2008, fing ich mit dem Englisch-Unterricht an, den ich eben kurz erwähnt habe. Damals war ich auch fertig mit meinem Studium an der Hochschule. Das war am Aschenberg. Ich sollte Kinder spielerisch an die englische Sprache heranführen, mit Spielen und Liedern. Dann kamen sie in die Schule und ich unterstützte sie bei den Hausaufgaben. Das ging bis sie irgendwann auf der Realschule und zum Teil auf dem Gymnasium waren. Alles war ehrenamtlich. Und zu dieser Zeit bin ich der AWO beigetreten.
Was machst du hauptberuflich?
Ich bin Dozentin an der Hochschule. Ich lehre hauptsächlich im Fachbereich Sozial- und Kulturwissenschaften. Da unterrichte ich die Fächer Interkulturelle Kompetenz, Englisch und Suaheli als Fremdsprache. Ich habe nicht gedacht, dass ich einmal unterrichten werde, sondern bin davon ausgegangen, in einer internationalen Organisation zu arbeiten. Das kam dann so nebenbei. Ich habe damals als studentische Hilfskraft für einen Professor gearbeitet. Irgendwann fragte er, ob ich ihm nicht mit ein paar Kursen helfen könnte. Da habe ich ein paar Kurse übernommen, es wurden immer mehr und heute bin ich immer noch da.
Siehst du da Parallelen zu deinem Ehrenamt?
Auf jeden Fall. Eine Sache, die mir damals sehr geholfen hat, mich besser zu integrieren, nicht nur bei der AWO, sondern auch in meine Umgebung, war das Master-Studium in Interkultureller Kommunikation. Denn dadurch wurde mir klar, welche kulturellen Unterschiede da sind und was ich bräuchte, um mich besser anzupassen. Es war wie eine Beschleunigung.
Warum Collette Döppner zum Studieren nach Deutschland kam
Den Bachelor hast du in Kenia absolviert. Aus welchen Gründen hast du dich für den Master in Deutschland entschieden?
Als ich noch in Kenia an der Uni Nairobi studiert habe, habe ich einen jungen netten Mann, einen Herrn Döppner aus Fulda, kennengelernt. Er hat in Gießen studiert. Wir waren beide Mitglied der studentischen Organisation AIESEC. Ich kam dann für eine Konferenz mit anderen Kommiliton:innen nach Deutschland. Er hat uns damals betreut und das so gut, dass ich heute noch hier bin.
Wieso hast du dich dann für Fulda und keine andere Hochschule entschieden?
Mein Mann, damals mein Freund, hat noch studiert in Gießen. Er meinte, ich soll erstmal nach Fulda kommen, die Sprache lernen, während er weiter studiert. Danach entscheiden wir, wohin wir gehen. Seine Familie lebte in Fulda. Als arme Studentin ohne Geld war es die beste Lösung, bei seinen Eltern zu wohnen, bis er fertig war. Dann hatten wir unsere eigene Wohnung, haben geheiratet, die Kinder kamen. Heute, über 20 Jahre später, bin ich immer noch hier.
Wie bist du mit der deutschen Sprache umgegangen?
Ich kam Ende 2001 nach Deutschland, habe im folgenden Januar angefangen Deutsch zu lernen und wollte mich im September an der Hochschule immatrikulieren. Aber die Zeit zwischen Januar und September war nicht ausreichend, um das Deutsch-Niveau zu erlangen, das die Hochschule voraussetzte. Ich hätte B2 gebraucht. Dann habe ich sechs Monate lang den Anfängerkurs gemacht und mir anschließend die Lehrbücher für B1 und B2 gekauft und saß zwei Monate zu Hause und habe nur gelernt. Es hat damals gerade so geklappt, und ich konnte anfangen zu studieren. Den Rest habe ich an der Hochschule gelernt. Denn das Studium war bilingual, englisch und deutsch. Da habe ich meine Deutschkenntnisse weiter verbessert.
Wie hast du das Land und die Leute wahrgenommen, als du nach Deutschland kamst?
Da gab es viele Eindrücke. Der Winter war der Horror. Diese Kälte kannte ich nicht. Auch heute noch finde ich den Winter hart. Ich empfand die Menschen als zurückhaltender. Sie haben eine andere Art, auf Leute zuzugehen. Die Kenianer lachen zum Beispiel sehr viel. Das vermisse ich in Deutschland. Ich hatte damals auch meine Masterarbeit über Humor geschrieben, weil ich das verarbeiten musste. In Kenia lacht man nicht nur, wenn etwas lustig ist, sondern auch wenn man sich trösten will. Das ist eine Art Bewältigungsmechanismus. Hier lachte ich meist alleine, wenn ich mal einen Witz gemacht habe. Anders als in Kenia kann man auch hier nicht einfach beim Nachbarn klopfen, um gemeinsam eine Tasse Tee zu trinken. Vorher anzurufen, ist da besser. Solche Kleinigkeiten machten mir bewusst, in einer anderen kulturellen Umgebung zu sein. Aber dafür habe ich auch tolle Dinge gelernt, wie die Pünktlichkeit. Wir Kenianer haben es nicht so mit der Zeit. Es gibt andere Dinge, die wichtiger sind. Und hier zählt eben Pünktlichkeit zu einem der wichtigeren Dinge. Das musste ich erst lernen, und heute bin ich dankbar dafür. Denn ich brauche es für meinen Beruf und meine Beziehungen. Unterschiede gibt es aber auch im Bereich der Kirche.
Inwiefern?
Ich komme aus Nairobi, einer sehr offenen Großstadt. Ich bin als Katholikin groß geworden. Doch das Katholischsein ist in Kenia ganz anders als hier in Deutschland. Es ist offener, es wird in der Kirche getanzt, gelacht. Hier ist es konservativer. Ich merke das auch in der Stimmung der Menschen, in Dingen, die man nicht darf. In Fulda habe ich immer das Gefühl, es sei viel verboten. Meine Familie und ich verreisen oft. Immer wenn wir woanders waren und zurück nach Fulda kommen, fallen uns diese Unterschiede auf. Dass die katholische Kirche hier einen großen Einfluss hat, merkt man daran wie die Menschen denken.
Welche Erfahrungen Collette Döppner mit Rassismus gemacht hat
Hast du auch negative Erfahrungen gemacht?
Ja, leider. Das Thema für mich als Dunkelhäutige ist immer Rassismus. Ich finde das interessant, denn in Kenia hatte ich nie solche Erfahrungen und habe mich auch nie als anders empfunden. Ich gehörte einfach dazu. Ganz am Anfang war es ein komisches Gefühl, als Menschen manchmal stehengeblieben sind, um mich anzustarren. Später wurde es verbaler. Dass Menschen Dinge gerufen haben, wie „Wie sieht die denn aus?“. Einmal war ich mit meiner Tochter in der Innenstadt in der Fußgängerzone. Da kam ein Mann hinter uns auf dem Fahrrad und schrie uns an: „Gehen Sie weg!“ Ich schaute zurück und sagte ihm, er müsse aufpassen, weil das hier eine Fußgängerzone ist. Dann guckte er mich an und schrie laut „Scheiß Neger“. Das war für mich ein Riesenschock. Er war so aggressiv und hat seinen Rassismus nicht versteckt.
Was ist dann passiert?
Meine Tochter fing an zu weinen. Ich war total außer mir, wusste gar nicht, was ich tun sollte. Der Mann fuhr dann weg, und ich wusste nicht, ob ich hinter her laufen und was sagen sollte. Das war meine erste sehr direkte Erfahrung damit. Immer wieder passierten solche Dinge. Ich denke, dass ich meine Angst mittlerweile verloren habe und mich deshalb verbal besser verteidigen könnte, wenn jemand einen diskriminierenden Kommentar fallen lässt.
Hast du das Gefühl, dass die Gesellschaft seit damals toleranter geworden ist?
Vor zehn Jahren haben sich die Menschen ein wenig versteckt, wenn sie rassistische Bemerkungen gemacht haben. Und jetzt sagen sie es ganz offen. Aber auf der anderen Seite erlebe ich Menschen, die das Thema angehen und darüber diskutieren wollen. Das und dass Bewegungen wie Black Lives Matter so einen Einfluss auf unsere Kultur und unser Denken haben, zeigt in die Richtung von mehr Toleranz und Offenheit für das Thema, und das freut mich und gibt Hoffnung.
War es angesichts solcher Erfahrungen anfangs schwer für dich, dich hier zu Hause zu fühlen?
Ja. Ich kam als Erwachsene mit 25. Meine Sozialisierung war in Kenia bereits abgeschlossen. Aber durch das Studium konnte ich viele Unterschiede verstehen und sehen, was ich brauchte, um hier besser leben zu können.
Reist du heute noch oft in dein Heimatland?
Oft nicht. Ich war diesen Februar/März das erste Mal seit Corona wieder da. Wir haben in der Vergangenheit immer versucht, alle zwei Jahre hinzufliegen. Als die Kinder kleiner waren, bin ich jedes Jahr hin. Ich würde heute noch gern jedes Jahr hin. Denn ich bestehe aus beiden Kulturen. Wenn eine Seite zu viel ist, fühle ich mich aus der Balance.
Was würdest du Menschen raten, die heute nach Deutschland kommen, um sich wohlzufühlen?
Der Schlüssel ist immer die Sprache. Auch wenn man die deutsche Sprache als schwierig zu lernen empfindet, es lohnt sich. Durch diese Sprachkenntnisse kann man selbstständiger werden, in Kontakt treten mit anderen. Die Welt steht einem offen. Durch den Kontakt und den Ideenaustausch wächst man in diese neue Kultur hinein. Dann fällt es einem nicht mehr so schwer. Aber das funktioniert nur, wenn man seine Komfortzone verlässt, egal, wie schwierig es am Anfang ist. Deshalb finde ich die AWO so toll, weil wir die Möglichkeiten anbieten, dass Leute aus anderen Ländern und Kulturen hier etwas machen können.
Interview: Toni Spangenberg
 75ème Anniversaire d’AWO Fulda
75ème Anniversaire d’AWO Fulda